
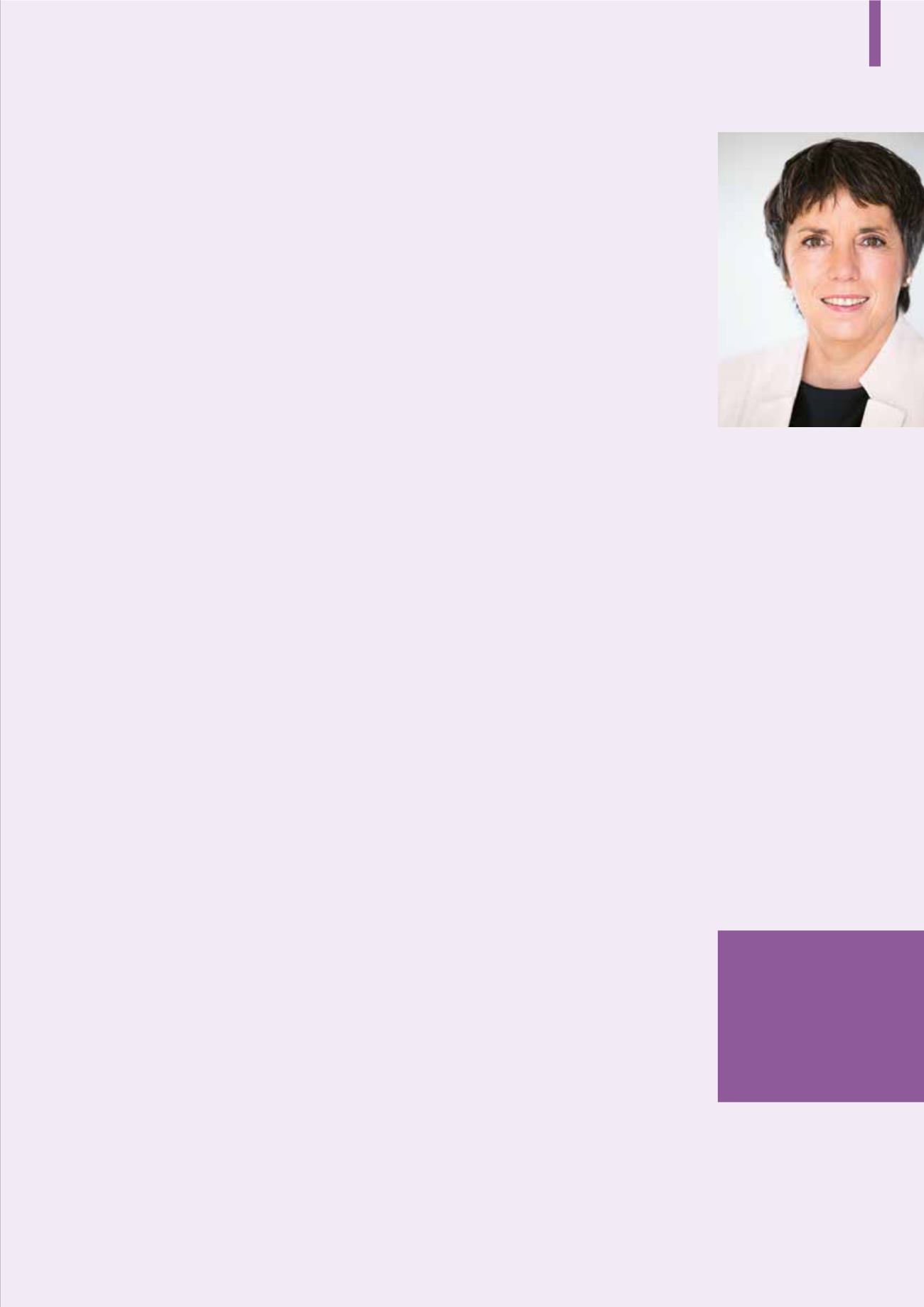
Impuls
„Der einzelne Mensch soll befähigt
werden, selbst zu lesen, sich ein
Urteil zu bilden, Fragen zu stellen,
Verantwortung zu übernehmen.“
noch einmal anders dar, spielt doch die Kolonial-
geschichte in der Zuwanderung eine ganz andere
Rolle.
Schlagartig bewusst wurde die neue Lage mit dem
11. September 2001 und seinen Folgen, dem Irak-
und Afghanistankrieg. Terroristen begründeten
ihr mörderisches Handeln jetzt oftmals mit Reli-
gion und Hass auf „Ungläubige“, damit Christen
meinend. Die Zuwanderung von Geflüchteten
muslimischen Glaubens führt zum Teil zu einer
vehementen Ablehnung durch die einheimische
Bevölkerung. In Deutschland entsteht die nahezu
absurde Situation, dass Kirchengemeinden sich
für diese Geflüchteten engagieren, während Men-
schen, die in keiner
Verbindung zur Kirche
stehen, erklären, sie
würden das christliche
Abendland verteidigen.
Und manche Staaten,
vor allem Frankreich,
die sich der Laicité ver-
schrieben haben, fragen sich, wie sie nun in einen
Dialog treten können. Die Frage steht im Raum:
Ist der Islam demokratiekompatibel? Gibt es ein
friedliches Miteinander der moderaten Kräfte in
allen Religionen? Wie gestaltet sich ein Zusam-
menleben von Menschen verschiedener Religion
und ohne Religion? Und wie lässt sich Terror ab-
wehren, ohne Demokratie zu gefährden?
Ein letzter Punkt: Luthers Antijudaismus, ja wohl
auch Antisemitismus, haben wir in Deutschland
in den letzten Jahren intensiv beraten. Unsere
Synode hat sich imNovember 2015 klar von seinen
Judenschriften distanziert. Wir haben aus dem
Versagen, Juden vor der Verfolgung durch die
Nationalsozialisten geschützt zu haben, dieser
Schuldgeschichte unseres Landes und auch un-
serer Kirche gelernt. Und doch müssen wir jetzt
realisieren, dass es einen neuen Antisemitismus
gibt und zwar nicht nur in Deutschland. Hier muss
es eine klare Haltung von Kirche und Politik ge-
rade auch gegenüber sogenannten Rechtspopu-
listen wie Herrn Höcke sowie der AfD und Herrn
Wilders sowie der „Partei für die Freiheit“ geben.
Welche Konsequenzen lassen sich daraus ziehen?
Zum einen ist mir wichtig, dass es der Reformation
um gebildeten Glauben ging. Der einzelne Mensch
soll befähigt werden, selbst zu lesen, sich ein Urteil
zu bilden, Fragen zu stellen, Verantwortung zu
übernehmen. Das scheint mir die beste Abwehr
gegen Fundamentalismus, denn Fundamentalis-
mus mag keine Fragen, da heißt es: Glaub oder geh
bzw. Glaub oder stirb.
Zum anderen: Die Aufgabe der Religion ist es, dazu
beizutragen, Konflikte zu entschärfen statt sie zu
verschärfen. Das ist im Grunde ebenso eine Lek-
tion aus der Reformation, denn die zerstörerischen
Kräfte, die mit dem 30-jährigen Krieg ganz Europa
überzogen, widersprachen am Ende Luthers
Grundsatz, dass nicht „mit Gewalt und Töten für
das Evangelium gestritten wird.‘“ Mir scheint das
die entscheidende Herausforderung, vor die wir
heute gestellt sind.
Zuletzt: Es geht darum,
dialogfähig zu sein,
miteinander und mit
der säkularen Welt.
Dazu ist es wichtig,
dass Religion eine Spra-
che findet, die „dem Volk auf´s Maul schaut“ wie
Luther das ausdrückte, aber nicht nach dem
Munde redet. Religion muss diskursfähig sein, um
sich einzubringen in die Auseinandersetzungen
unserer Zeit.
All diese Fragen werden wir diskutieren bei der
Weltausstellung Reformation unter dem Thema
„Tore der Freiheit“ in Wittenberg von Mai bis
September in diesem Jahr. Wie sieht es aus mit der
Ökumene und demDialog der Religionen? Was ist
heute Spiritualität? Wie stellen wir uns zu den
Herausforderungen der Globalisierung und von
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöp-
fung? Welche Rolle spielt die Jugend heute? Das
tun wir mit vielen Gästen aus aller Welt, in inter-
nationaler Perspektive und im ökumenischen
Horizont. Alle sind herzlich eingeladen, dabei zu
sein. Denn das ist typisch reformatorisch: Erneu-
erung entsteht durch Lesen der Bibel und Gespräch
unter Menschen, die bereit sind, sich zu beteiligen.
Margot Käßmann
Margot Käßmann
„Tore der
Freiheit“
Weltausstellung
Reformation
in Wittenberg
von Mai bis September 2017
„Aus der Heimstiftung“
1/2017
19











